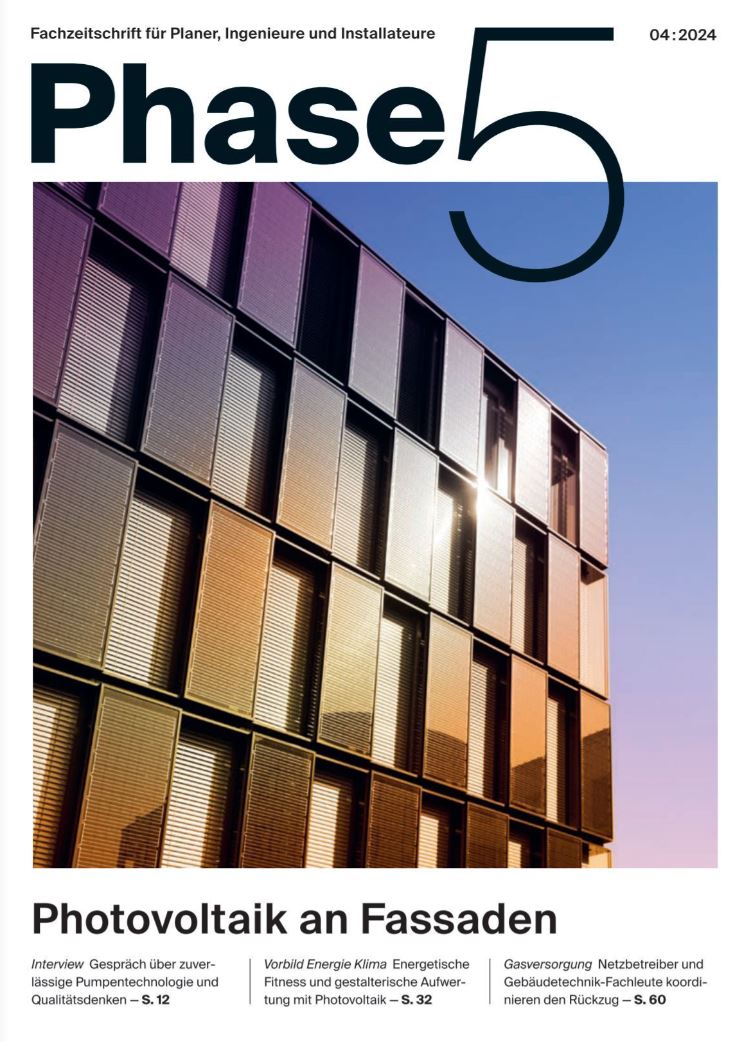Über 110 Vertretende der Gebäudetechnik-Industrie trafen sich Ende September für einen fachlichen Austausch in Aarau. Der Round Table Gebäudetechnik wird alljährlich von GebäudeKlima Schweiz und der Schweizerischen Normen-Vereinigung organisiert. Diskutiert wurden neue Vorschriften, grüner Wasserstoff, thermische Netze sowie Fragen zur Qualitätssicherung und zu brennbaren Kältemitteln bei Wärmepumpen.
«Befindet sich unsere Branche in der Krise?», fragte Konrad Imbach, Geschäftsleiter von GebäudeKlima Schweiz (GKS), zum Start des diesjährigen Round Table Gebäudetechnik. Über 110 Vertretende von Herstellern und Lieferanten der Gebäudetechnik-Branche sowie von Behörden und Verbänden hatten sich Ende September auf Einladung von GKS und der Schweizerischen Normen-Vereinigung (SNV) zum alljährlichen fachlichen Austausch getroffen. Mit ein Grund für die rekordhohe Teilnehmerzahl dürfte tatsächlich der von Konrad Imbach aufgezeigte Rückgang der Marktzahlen 2024 sein. Diese werden von GKS, dem bedeutendsten Schweizer Hersteller- und Lieferantenverband der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, quartalsweise erfasst.
Von einer Krise mochte in Aarau nach den vergangenen Rekordjahren trotzdem niemand sprechen. Die Herausforderungen aber bleiben zahlreich. Das widerspiegelt sich zum Beispiel in der Revision 2025 der Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich, wie Olivier Brenner von der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren aufzeigte. So ist man zwar auf dem richtigen Weg zur Erreichung der gesetzlich vorgegebenen CO2-Ziele bis 2030: Im Rahmen von Heizungssanierungen wurden im Jahr 2023 in 85 % der Fälle erneuerbare Wärmeerzeuger gewählt und die CO2-Emmissionen im Sektor Gebäude sinken in jüngerer Vergangenheit schneller. Es braucht aber weitere Anstrengungen, sowohl bei der Gebäudehülleneffizienz, als auch bei der erneuerbaren Wärme- und Stromerzeugung. In den MuKEn 2025 sind deshalb nun unter anderem 100 % erneuerbare Wärme bei Neubauten und beim Wärmeerzeugerersatz vorgesehen. Neu sind zudem Vorschriften zur Eigenstromerzeugung auch bei Dachsanierungen festgehalten, während jene für Neubauten verschärft wurden. Unklar ist aktuell jedoch die Zukunft der Fördermassnahmen. Dabei sei eine Kombination von Lenken, Fordern und Fördern wichtig, um Akzeptanz zu schaffen, wie Olivier Brenner anmerkte.
Wie weiter mit grünem Wasserstoff?
Mit welchen Energieträgern aber sollen die 100 % erneuerbare Energie bis 2050 erreicht werden? Hierzu stellte Hubert Palla am Round Table zur Diskussion, ob grüner Wasserstoff bei der zukünftig erneuerbaren Energiewirtschaft tatsächlich eine essentielle Rolle spielen werde. Der ehemalige technische Berater des Verbandes der Schweizerischen Gasindustrie hielt fest, dass die erfolgreiche Etablierung einer Wasserstoffwirtschaft in der Schweiz primär ein Wettlauf gegen die Zeit sowie andere Energieträger und Technologien sei. Es brauche marktfähige Preise und eine zuverlässige, sichere Versorgung. Letzteres wiederum würde teilweise hohe Investitionen unter anderem in die Infrastruktur erfordern, die sich zurzeit jedoch nicht abzeichnen.
Kräftig investiert wird hingegen in thermische Netze: Bereits heute gibt es in der Schweiz rund 1200 davon und das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft. Der Boom bringt aber auch grosse Herausforderungen für die Branche mit sich. Dazu gehören die unterschiedlichen technischen Anschlussbedingungen beziehungsweise -vorschriften (TAB/TAV). Fast jedes Werk habe eigene Vorschriften, die teilweise erst noch schwierig zu besorgen seien, wie Philipp Zulian von Oventrop erklärte. Da brauche es eine Standardisierung. Auch die Wichtigkeit von möglichst tiefen Rücklauftemperaturen im Wärmeverbund, gut ausgebildeten Technikern sowie einer funktionierenden Kommunikation zwischen Herstellern, Planern, Installateuren und Betreibern unterstrich er. GKS unterstützt hier seit diesem Jahr mit einer Fachgruppe Übergabestationen und erfasst neu auch die Absatzzahlen der Übergabestationen.
Merkblatt für Umgang mit brennbaren Kältemitteln
Auch bei den Wärmepumpen zeigen sich abgesehen von den Absatzzahlen weitere Herausforderungen. Oliver Joss von der Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz gab eine Übersicht zu verschiedenen Qualitätssystemen wie das Wärmepumpen-System-Modul oder die Leistungsgarantie Wärmepumpen, die bei grösseren Wärmepumpen oft Bedingung für Fördermittel ist. Bei der Leistungsgarantie sei aber eine Überarbeitung notwendig. GKS-Geschäftsleiter Konrad Imbach gab diesbezüglich jedoch zu bedenken, dass Qualitätssicherung aus Sicht der Industrie nicht zu mehr Aufwand und Kosten führen dürfe. «Schliesslich produzieren wir unsere Produkte bereits nach geltenden Normen.»
Auf die Thematik der natürlichen Kältemittel ging Robert Diana von Suissetec ein. Diese kommen aufgrund des schrittweisen Verbotes von fluorierten Kältemitteln in der EU zukünftig breit zum Einsatz. Viele von diesen sind jedoch brennbar und/oder toxisch und stellen Planungs- und Installationsunternehmen entsprechend vor neue Herausforderungen. Mehrere Organisationen haben deshalb unter der Federführung von Robert Diana gemeinsam das Merkblatt «Umgang mit Wärmepumpen und Kälteanlagen mit gering toxischen, brennbaren Kältemitteln» erarbeitet. Damit sollen Informationslücken geschlossen und ein sicherer Aufbau und Betrieb von entsprechenden Anlagen ohne Personen- und Sachschäden gewährleistet werden. Das Merkblatt wird noch dieses Jahr veröffentlicht. Ab 2025 sind zudem Schulungen für Installateure und Planer geplant.
«Da kommt einiges auf uns zu»
Von weiteren zukünftigen Vorschriften aus der EU berichtete Barbara Guder von der SNV. So ist seit Juli die neue EU-Verordnung «Ökodesign für nachhaltige Produkte» (EU-ESPR) in Kraft. Sie ersetzt die alte Ökodesign-Richtlinie mit einer Übergangsfrist für die darin bisher regulierten Produktegruppen bis Ende 2026. Neu werden in der EU-ESPR aber Anforderungen an fast alle Waren gestellt, die in der EU in Verkehr gebracht werden. Eine der Anforderungen ist ein digitaler Produktepass, in dem Daten etwa zu Materialien und deren Herkunft oder den Umweltauswirkungen im Lebenszyklus festgehalten sind. Bereits seit 2023 gilt in Deutschland zudem das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). Durch dieses «ESG-Gesetz» sollen Unternehmen dazu gebracht werden, nachhaltiger zu wirtschaften und mehr soziale Verantwortung zu übernehmen. Es gilt für Unternehmen in Deutschland mit mehr als 1000 Mitarbeitenden und verpflichtet diese dazu, menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten in ihren Lieferketten umzusetzen. Diese Sorgfaltspflichten beziehen sich auch auf das Handeln von Vertragspartnern oder mittelbaren Zulieferern. Damit können auch Schweizer Unternehmen zur Einhaltung von Compliance-Vorgaben verpflichtet werden, wenn sie Teil der Lieferkette sind, betonte Barbara Guder. Das deutsche LkSG diente zudem als Vorlage für die EU-Lieferketten-Richtlinie, die seit Mitte Juli gilt und bis Mitte 2026 in nationales Recht der EU-Mitgliedstaaten umgesetzt werden muss.
«Da kommt einiges auf uns zu, auf das man sich besser früher als später vorbereitet», betonte Konrad Imbach in seiner abschliessenden Zusammenfassung. Er zeigte sich aber überzeugt, dass die Branche diese Herausforderungen meistern werde, auch mit Unterstützung von GKS als Plattform für den Wissenstransfer untereinander sowie als Stimme der Industrie gegenüber Politik, Behörden und anderen Verbänden. Für Konrad Imbach selber war der elfte gleichzeitig der letzte Round Table Gebäudetechnik. Ab 2025 übernimmt Marco von Wyl die GKS-Geschäftsleitung, der die Gelegenheit des diesjährigen Round Table nutzte, um sich den Anwesenden vorzustellen, auf der Bühne sowie in persönlichen Gesprächen beim Apéro Riche zum Ausklang des Branchenanlasses.
Impressum
Textquelle: GKS
Bildquelle: GKS
Bearbeitung durch: Redaktion Phase 5
Weitere Artikel
Veröffentlicht am: