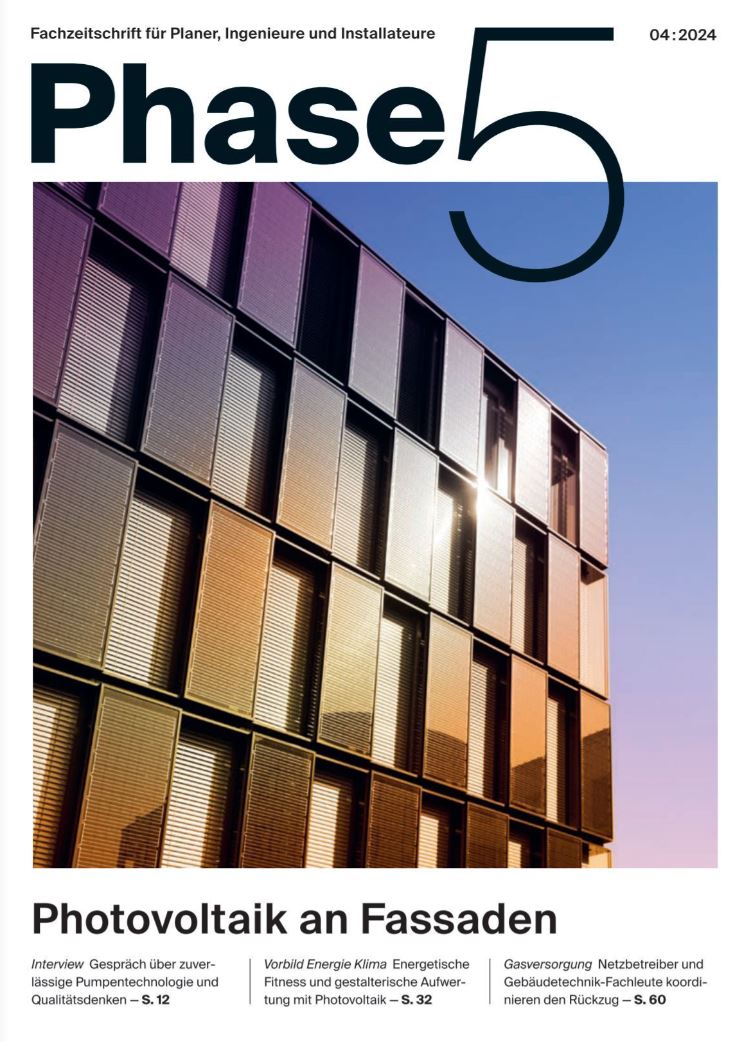Zur CO2-freien Wärmeversorgung zapfen Hausbesitzer natürliche Energiequellen wie das oberflächennahe Erdreich an. Doch geothermische Heizsysteme sollen nicht nur Wärme beziehen, sondern diese vermehrt in den Boden zurückspeisen – empfehlen Bewilligungsbehörden neuerdings.
Text: Paul Knüsel
Die Wärmepumpe ist das beliebteste Heizsystem der Schweiz. Seit 2020 übertreffen ihre Absatzzahlen am Jahresende jeweils diejenigen für Heizungsanlagen mit Öl, Gas oder Holz. Den Markterfolg verdeutlicht die neuste Entwicklung: Allein im ersten Halbjahr 2025 waren zwei Drittel der neu installierten Wärmeerzeugungsanlagen eine Wärmepumpe. Am häufigsten werden Wärmepumpen zum Beheizen von kleinen bis mittelgrossen Wohn- und Geschäftsbauten verwendet. Drei von vier Neuanlagen gehören in die Leistungskategorie bis 20 kW. Und fast jede Dritte Neuanlage ist mit Erdwärmesonde bestückt, weist die aktuelle Statistik zur «Marktentwicklung Schweiz» der Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz (FWS) aus.
Geothermie Schweiz freut sich ebenfalls an diesem Erfolg: Die Schweiz führt die globale Statistik der geothermischen Wärmeversorgung an, dank einer installierten thermischen Leistung von über 5 MW/100 km2. Die Erdwärmepumpe, die ihre Energie aus dem oberflächennahen Erdreich bezieht, ist nirgendwo sonst derart beliebt. Branchenschätzungen zufolge sind inzwischen rund 100'000 Erdwärmepumpen, gekoppelt an mindestens eine Erdwärmesonde, im Gebäudepark Schweiz verbaut.
Verdoppelung des Wärmebezugs
Dass es noch viel mehr braucht, ist jedoch ein energiepolitisches Ziel. Liefert das Erdreich aktuell knapp 4 TWh Energie für das Beheizen von Gebäuden, geht die Energiestrategie 2050 des Bundes von einem Gesamtbedarf von 8 TWh aus. Dem Bund und den Kantonen drängt sich nun aber die Frage auf, ob der geothermische Wärmefluss die erhoffte Verdoppelung des Energiebezugs verkraften kann. Das Bundesamt für Energie sondierte das Ausbaupotenzial vor wenigen Jahren Die Studie „zur Sicherstellung einer nachhaltigen Erdwärmenutzung» warnt seither: Die Ressource «steht nicht unbegrenzt zur Verfügung». Langfristig sei mit einem Mangel an natürlicher Umweltwärme zu rechnen, so die BFE-Erdwärmestudie.
Der Kanton Baselland befürchtet genau dies, falls der Zubau an Wärmepumpen in Wohnquartieren das prognostizierte Niveau erreichen wird. Problematisch wird insbesondere die enge Nachbarschaft: Erdwärmesonden können im Lauf der kommenden Jahre so dicht nebeneinander abgeteuft werden, dass eine gegenseitige thermische Beeinflussung nicht ausgeschlossen werden kann. «Abhängig von der Anlagedichte kann das Erdreich stärker als geplant abkühlen», bestätigt Roland Wagner von der Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft.

Pflicht zur Regeneration?
Um die drohende Auskühlungsgefahr von vornherein zu vermeiden, hilft ein einfaches Mittel: Der Wärmentzug ist energetisch zu kompensieren. Dem Boden soll inskünftig nicht nur Energie entzogen werden dürfen, sondern bei Bedarf auch Wärme zugeführt werden müssen. Der Kanton Baselland prüft gemäss Wagner, ob das Erdreich nicht nur geothermisch genutzt, sondern auch aktiv regeneriert werden soll respektive für welche Gebieten sogar eine Regenerationspflicht angeordnet wird. Diese Vorschrift wäre ein Präzedenzfall für die Schweiz. Bis Ende Jahr wird geklärt, welche Handlungsoptionen für die praktische Umsetzung angezeigt sind.
Weitere Kantone prüfen ihrerseits vergleichbare Regenerationsauflagen. Die Stadt Basel konkretisierte bereits ihren Handlungsbedarf im dichten Siedlungsgebiet. Das saisonale Regenerieren des Erdreichs soll gemäss dem Energierichtplan in Quartieren mit sehr hohem, spezifischem Wärmebezug geprüft werden. Der generelle Tenor lautet jedoch: Eine flächendeckende Wärmerückführungspflicht für Erdwärmesonden wird als unverhältnismässig beurteilt.
Gute Planungspraxis
Akut ist das Problem einer geothermischen Übernutzung effektiv noch nicht. Gemäss Ernst Rohner, Inhaber der Geotechnikfirma Engeo, sei die heutige Planungspraxis von guter Qualität und auf einen effizienten Heizbetrieb von Wärmepumpen für mindestens 50 Jahre ausgerichtet. Erst vor vier Jahren wurde die SIA-Norm SIA 384/6 «Erdwärmesonden» diesbezüglich aktualisiert. Seither muss die Fachplanung auch die Umgebung und die Zukunft betrachten. Zur Dimensionierung von Erdwärmesonden-Anlagen sind neben der bestehenden, auch die geplante geothermische Nutzung in der Nachbarschaft zu berücksichtigen.
Das FWS-Wärmepumpensystemmodul (WPSM) bietet zusätzliche Gewähr, dass diese Planungsregeln eingehalten sind. Der Nachweis für die Nachbarschaftsabklärungen ist integrierter Bestandteil der Leistungsgarantie, in welcher die korrekte Auslegung unternehmensseitig bestätigt werden muss, ergänzt WPSM-Projektleiter Andreas Dellios von der Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz.
Gezieltes oder dauerhaftes Überwachen
Trotzdem gibt es Ausnahmen von der Regel. «Wir entdecken bei Nachkontrollen ab und zu eine mangelhafte Auslegung bei der Erstinstallation», sagt Rohner. Solche Planungsmängel sind entweder zu kurze Erdwärmesonden oder benachbarte Sonden, die später dazu gekommen sind. Der negative Effekt ist jeweils vergleichbar. Der Wärmeentzug überfordert das Erdreich, sodass dieses rund um eine Erdwärmesonde unzulässig abkühlt. Feldanalysen in Siedlungsgebieten mit starkem Wärmentzug zeigen, dass das Erdreich selbst 20 m von der Sonde entfernt um über 5 °C auskühlt.
Eine naheliegende Vorsichtsmassnahme ist das dauerhafte Überwachen der Temperaturen im Erdsondenkreislauf. In Grossanlagen mit mehreren Erdsonden oder ganzen Erdsondenfeldern gehört das zum Monitoringstandard. Kleine Wärmepumpenanlagen bis 15 kW werden dagegen erst teilweise mit Temperaturfühler ausgestattet, bestätigt FWS-Qualitätsmanager Dellios. Damit der Kreislauf in der Erdsonde nicht gefriert, wird dem Medium ein Frostschutzmittel beigemischt.
Bei Bedarf könne jederzeit eine Zusatzkontrolle von aussen veranlasst werden, um die Temperaturen im Vor- und Rücklauf einer Erdwärmesonde zu messen. Alternativ dazu lässt sich das Geschehen im Erdreich indirekt über den Betrieb der Wärmepumpe nachverfolgen. Steigt der Stromverbrauch von Jahr zu Jahr an, ist dies «ein mögliches Indiz dafür, dass das Erdreich zu stark auskühlt», so Dellios. Bestätigt sich dieser Befund, ist die wirkungsvolle Gegenmassnahme: eine thermische Regeneration.
Regeneration im Standardbetrieb
Viele Grossanlagen mit Erdsondenfeld werden nicht nur laufend kontrolliert, sondern zum Standardkonzept gehört auch eine Wärmerückführung. Üblicherweise wird ein daran gekoppeltes Anergienetz saisonal unterschiedlich betrieben: Im Winter dient die Erdwärme als Energiequelle für den Heizbetrieb; im Sommer bietet sich das Sondenfeld als Rückkühlreservoir für die gebäudespezifische Kälteversorgung an. Dank der Wärmezufuhr von aussen regeneriert sich das Erdreich saisonal. Jeweils vor Beginn der Heizperiode pendelt sich die Temperatur im oberflächennahen Erdreich auf demselben Niveau wie im Vorjahr ein.
Die geothermische Wärmebilanz gleicht sich jedoch nur im Idealfall aus, wenn ausreichend Energie rückgeführt werden kann wie bei Gebäuden oder Siedlungsarealen mit hohem Kühlbedarf. Bei kleinen Wohnhäusern, die mit Wärmepumpe beheizt werden, ist das Regenerationspendel dagegen zu leicht. Der Wärmeeintrag im Sommer durch ein kühlendes Geocooling ist viel geringer als die Energie, die im Winter zu Heizwecken dem Boden entzogen wird. «Der Regenerationsanteil erreicht nur 10 bis 15 %», sagt Engeo-Inhaber Rohner. Wirksamere Technologien zur Wärmerückführung gibt es deshalb auch.
Regenerieren mit Sonnenenergie?
Leistungsfähigere Regenerationsverfahren sind jedoch auf zusätzliche Energiequellen von ausserhalb angewiesen wie zum Beispiel Abwärme aus gewerblicher Nutzung, Solarthermie oder warmer Abluft aus einer Tiefgarage. Letztere kann mit einem Luft-Wärmetauscher technisch einfach und preisgünstig genutzt werden. Wird dagegen die Sonne zur saisonalen Erwärmung des Erdreichs verwendet, braucht es dazu eine aufwändigere Technik. Bei Einzelgebäuden oder Siedlungsarealen werden etwa thermische Sonnenkollektoren oder kombinierte PVT-Anlagen eigens zur geothermischen Regeneration genutzt. Wissenschaftliche Studien weisen sogar darauf hin, dass der geplante Ausbau der oberflächennahen Geothermie im Siedlungsraum nur möglich ist, wenn parallel dazu mehr Sonnenenergie für eine Wärmezufuhr in den Boden genutzt wird.
Impressum
Textquelle: Paul Knüsel
Bildquelle: Engeo AG
Bearbeitung durch: Redaktion Phase 5
Informationen
Weitere Artikel
Veröffentlicht am: