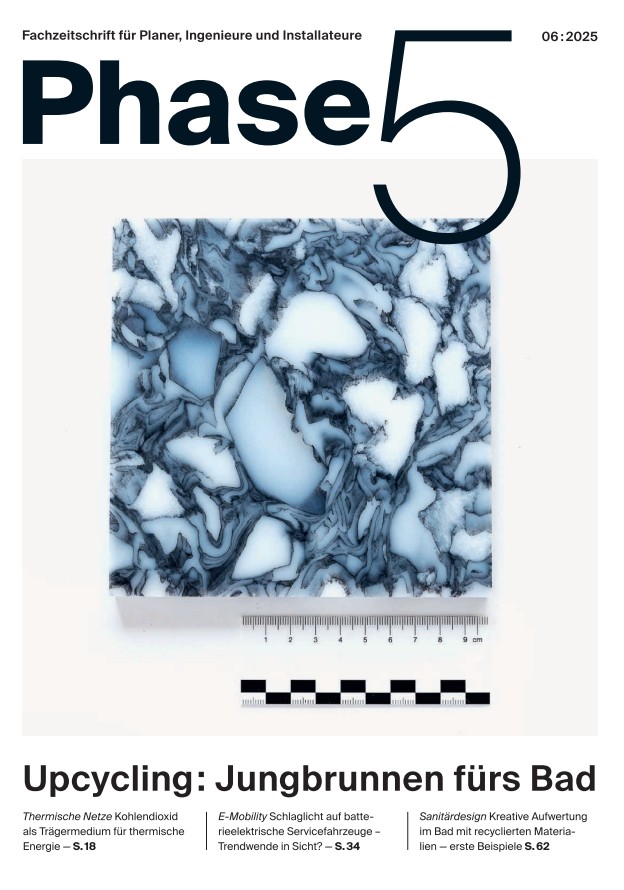Elektrische Impulse können die Struktur der Kalkkristalle in Wasserleitungen so verändern, dass sie sich weniger ablagern. Mit dieser Technologie arbeiten die Kalkschutzgeräte von Hydro Service. Eine Machbarkeitsstudie des Hightech Zentrums Aargau belegte deren Wirksamkeit.
Redaktionelle Bearbeitung: Phase5
Bei herkömmlichen Enthärtungsanlagen muss das Wasser mit Regeneriersalz chemisch behandelt werden, um Kalkbildner wie Kalzium oder Magnesium zu reduzieren. Die physikalische Methode der Hydro Service Schweiz AG ist ressourcenschonender, weil kein Salz nachgefüllt und kein Trinkwasser durch Rückspülung verschwendet werden muss. Die Geräte werden an Leitungsrohre angebracht und generieren ein Feld aus elektrischen Impulsen. Das Prinzip nennt sich Electric Anti Fouling (EAF).
Überzeugungsarbeit nötig
Über 15'000 Haushalte hat Hydro Service in den letzten zehn Jahren mit Aquazino-Geräten ausgestattet. Weil die Sanitärbranche skeptisch blieb, musste das Unternehmen den Marktaufbau selbst stemmen. Doch auch bei den Endabnehmern war Überzeugungsarbeit nötig. Zwar kamen mit der Zeit Grosskunden aus der Immobilienbranche wie die AXA Anlagestiftung mit ihrer Telli-Siedlung in Aarau hinzu. «Aber mein Team und ich werden immer wieder gefragt, ob man wissenschaftlich beweisen kann, dass und wie EAF funktioniert», sagt Federico Bussmann, Leiter Firmenkunden.
Hydro Service machte sich deshalb auf die Suche nach einem Forschungspartner. Fündig wurde man bei der Hochschule für Life Sciences FHNW in Muttenz. Marco Martinovic baute am Institut für Chemie und Bioanalytik (mit Dr. Sina Saxer) und am Institut für Ecopreneurship (mit Dr. Sebastian Hedwig) eine Testanlage zur gezielten Messung von Kalkablagerungen auf. Für deren Finanzierung kamen das Hightech Zentrum Aargau (HTZ) im Rahmen einer Machbarkeitsstudie und die schweizerische Innovationsagentur Innosuisse auf.
Verblüffende Testergebnisse
Mit der Testanlage lassen sich Leitungssysteme simulieren, die sich etwa in Sachen Wassertemperatur, Kalziumkarbonat-Gehalt oder Fliessgeschwindigkeit unterscheiden. Um möglichst viel Kalkablagerung in der kurzen zur Verfügung stehenden Testzeit von 18 Stunden zu generieren, wurde mit sehr hartem Wasser und starken Temperaturunterschieden gearbeitet. «Trotz dieser extremen Bedingungen reduzierten die getesteten Aquazino-Geräte die Kalkablagerungen signifikant um 20 bis 30%», sagt Sina Saxer.
Gleichzeitig blieb die Wärmeübertragung im eingesetzten Wärmetauscher um 60 bis 90% effizienter als ohne Gerät – «ein verblüffendes Ergebnis, das die Wirksamkeit der Technologie bestätigt», resümiert Saxer. Damit war der Beweis erbracht, dass die EAF Methode tatsächlich einen signifikanten Effekt auf Kalkablagerungen hat. «Endlich können wir dokumentieren, dass unsere Geräte die versprochene Funktion erfüllen», freut sich Sascha Benz, Teilhaber von Hydro Service.
«Unsere Machbarkeitsstudie hatte zum Ziel, nicht nur den Effekt zu prüfen, sondern auch eine wissenschaftliche Basis für die Produktentwicklung in der Zukunft zu liefern», sagt Marco Romanelli, Technologie- und Innovationsexperte beim HTZ. Das Innovationspotenzial der momentan nur für Frischwasser konzipierten Geräte liegt in geschlossenen Wasserkreisläufen, zum Beispiel in Wärmepumpen. Auch in darin verbauten Wärmetauschern kann es zu Ablagerungen von Mineralien kommen, was die Effizienz von Geothermie-Heizungen mindert.
Impressum
Textquelle: Hightechzentrum Aargau
Bildquelle: Hydro Service Schweiz AG
Bearbeitung durch: Redaktion Phase 5
Informationen
Weitere Artikel
Veröffentlicht am: